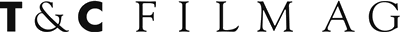Daniel Schmid zu seinem Film.
Ich verstehe mich selbst immer mehr als Grenzgänger auf der schwankenden Linie zwischen Wirklichkeit und Traum, zwischen Realität und Imagination. Seit ich mich erinnern kann, habe ich auf diesem schmalen Grenzpfade Sachen hinüber- und herübergeschmuggelt.
Einen Film zu machen mit alten Opernstars, die längst vergessen in einem Palazzo in Mailand leben, kam meinem Interesse für dieses Grenzgebiet zwischen Fiktion und Dokumentation entgegen.
Die Gefahr, die das Thema an sich beinhaltet, nämlich das Pathetische verbunden mit dem Banalen, das Groteske daran und die damit wieder verbundene Blosstellung, war mir bewusst. Auch hier dieser schwankende Grenzpfad.
Diese ehemaligen Sängerinnen und Sänger leben alle die Geschichte ihres Lebens in einem fiktiven Raum und keiner weiss mehr genau, was wahr ist und was war. Sie behaupten, sie seien 80 Jahre alt, und sind 90; die Koffer stehen reisefertig im Zimmer, obwohl sie schon seit zehn, zwanzig Jahren hier wohnen. Und die Zeit seit dem letzten Auftritt schrumpft auf wenige Jahre zusammen. Fragt man sie, wann sie die letzte Platte besungen haben, antworten sie: «Es sind mindestens drei, vier Jahre her» – in Wirklichkeit aber sind vielleicht 40 oder 45 Jahre vergangen. Die Grenze zwischen Realität und Einbildung verschiebt sich bei ihnen in äusserster Transparenz, was mir sehr liegt, da dies auch bei mir dauernd der Fall ist. Es bildet sich eine Art Zwischenrealität heraus; denn wenn man sich dreissig Jahre lang etwas eingebildet hat, dann wird man zu dem, ob es stattgefunden hat oder nicht. Dazu kommt, dass die einstigen Sängerinnen und Sänger sich durch die notwendige, gesunde Portion Exhibitionismus auszeichnen, die es braucht, um auftreten zu können. Und schliesslich war unsere Arbeit selbst der Versuch eines Spiels mit den Grenzen zwischen Dokumentation und Fiktion. Um das zu verdeutlichen, muss ich ein wenig ausholen:
Jede Filmaufnahme ist, durch das Vorhandensein der Kamera, ein terroristischer, pornographischer Akt. Und je ernsthafter unser Metier ausgeübt sein will – im handwerklichen Sinn, denn ich verstehe mich nicht als Künstler, sondern als Handwerker – desto mehr ist man in einer vampiristischen Rolle; das heisst, man saugt die Kraft derer, die davorstehen aus und provoziert sie dadurch. Das war sicher auch in Mailand der Fall; nur wussten diese Leute von der Bühne bestens was los war. Das gab uns von vornherein die Möglichkeit, mit ihnen als Komplizen zu rechnen und spielerisch miteinander umzugehen. Es existiert ja eine fliessende Abhängigkeit zwischen «Vampiren» und ihren «Opfern».
Dies hat sicher mit Manipulation zu tun; aber erstens ist dies die Basis jeglicher Regiearbeit, und zweitens fand sie hier in einem komplizenhaften Verhältnis statt. Ein alter Sänger lagerte im Keller noch seinen grossen Koffer von den Transatlantik-Tourneen. Wir hörten davon und gingen gemeinsam in den Keller und drehten die Szene mit dem alten Opernehepaar, das seine Kostüme von längst vergangenen Aufführungen anprobierte. Oder die Geschichte mit Sara Scuderi, die in den zwanziger Jahren eine der grossartigsten Tosca-Darstellerinnen war und heute 80 Jahre zählt: Sie wollte nicht singen, da es ihr der Arzt verboten habe. Aber als ich am Klavier ein Puccini-Motiv anschlug, veränderte sich etwas in ihr, und sie wurde für einen Augenblick wieder eine Primadonna, die 3000 Zuschauer vor sich hat. Und für den Schluss des Filmes bauten wir bei einem Vorhang der Casa eine Bühne auf, spielten einen Applaus der Scala ein und inszenierten «Last Curtain Calls». Alle kamen hinter dem Vorhang hervor und verbeugten sich ein letztes Mal. Ja, hinter dem Vorhang ging ein Gerangel los, Stäcke wurden weggeschmissen, das Alter, die Schmerzen, die Gebrechen waren vergessen, und es wurde nach vorne gedrängt – im vollen Bewusstsein, dass dies eine fingierte Situation war.
Auch wenn die Gesten und Allüren dieser ehemaligen Stars bisweilen groteske Züge annehmen, strahlen sie auch eine Würde und Grösse aus, die einzigartig ist. Die Institution «Casa Verdi» als Ganzes ist etwas Wunderbares; sie befindet sich auch im für mich grossartigsten, menschlichsten Land der Welt. Wenn Kultur das ist, was übrigbleibt, wenn man alles vergessen hat, so ist das in Italien dauernd und überall gegenwärtig. In der «Casa Verdi» sind sogar die Zimmermädchen Enzyklopädien des dramatischen Musiklebens: Dieses Personal hätte Pasolinis Herz entzückt. In keinem anderen Land gibt es etwas ähnliches. Nur in Italien gibt es diese Art von humaner Kultur, die keine «bürgerliche» ist, die alles durchdringt und die auch die Existenz einer solchen Institution in ihrer Einmaligkeit erlaubt.
«La voce in bellezza», das sind ein paar Jahre, vielleicht zehn; und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo es talwärts geht und der Sänger sich fragen muss, ob er aufhören soll oder nicht. Die Bewohner der «Casa Verdi» haben diese Erfahrung alle hinter sich und sitzen nun hier in ihren Zimmern – geschützter als andere alte Leute; denn die Casa hat einen Arzt, drei Schwestern, ein physioterapeutisches Institut und insgesamt etwa zwanzig Angestellte, die sich um das Wohl der Pensionäre kümmern. Der äussere Rahmen ihres Lebens hat sich reduziert auf die in allen Zimmern identische Einrichtung, auf ein paar Erinnerungsfotos, Postkarten und den Fernseher, an dem sie sich ab und zu eine Opernübertragung anschauen: Auf der ganzen Welt findet sich kein kritischeres Opernpublikum: Fast alle Aufführungen fallen bei ihnen durch, und besonders scharf werden die Sängerinnen und Sänger mit der jeweils gleichen Stimmlage kritisiert. In diesen kleinen Zimmern, die gar nicht an die grossartigen Aufenthaltsräume der Casa erinnern, sitzen sie vormittags, beschäftigt mit den stundenlangen Vorbereitungen für den «Auftritt» um 11 Uhr im Korridor. In den Gängen irren sie dann herum und warten, immer eine Stunde zu früh, in der Nähe des Speisesaals auf das Mittagessen. Einen «Auftritt» erlebte ich zum Beispiel im Fernsehzimmer, als ein ehemaliger Opernstar eintrat, das Eurovisionslied hörte und diese Musik mitsingend durch das leere Fernsehzimmer schwebte – so wie sie vermutlich auf der Scala-Bühne aufgetreten war.
Diese Auftritte sind ein immerwährendes «So Tun als ob», ein dauernd überhöhter Schritt. Aber es hat mich beeindruckt, dass jeder auf seinem eigenen «Sender» ist, seiner eigenen «Radiostation», dass es kaum Freundschaften gibt. Dagegen herrscht noch immer heftige Konkurrenz, die anscheinend auch jung erhält: Will man mit jemandem reden, behaupten andere, diese Person sei gestorben. Dann öffnet sich die Türe, und die für tot Erklärte erscheint. In dieser Hinsicht sind sie absolut schamlos. Einmal habe ich offensichtlich zu ausführlich mit einer alten Sängerin gesprochen; am nächsten Tag war jedenfalls ihr Porträt von Puccini, das er ihr persönlich gewidmet hat, total zerkratzt. Und als ich fragte, wer zum Galaabend in die Scala komme, war die Reaktion allerorten die gleiche: «Für wen? Für die Callas? Nein, ich glaube nicht, dass ich gehe.» Sie lehnten auch wieder aus Konkurrenzgründen ab, aber auch, weil sie überzeugt sind, dass die Scala und die Oper allgemein sich im Niedergang befinden, und weil die Opern, in denen sie einmal gesungen haben, sie schmerzlich berühren.
 Dokumentar-Spielfilm,
Dokumentar-Spielfilm,
CH 1984, 87′, Farbe, Video/35mm
Regie Daniel Schmid
Originalversion: Italienisch